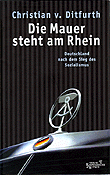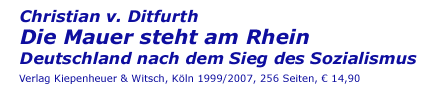
Aus Rezensionen
über "Die Mauer steht am Rhein":
"Eine atemberaubende
Lektüre"
Die Zeit
"Gott sei Dank nur
ein Alptraum. Aber was für einer!"
Der Spiegel
"Intelligent und
witzig"
ARD-Kulturreport
"Weltpolitischer
Albtraum"
Focus
"Geschichtszauberstück"
Spiegel Spezial
"Auf
seine ganz spezielle Art ist 'Die Mauer steht am Rhein' der Roman zur deutschen
Einheit - die realsozialistische Alternative zu Thomas Brussig."
Fuldaer Zeitung
"Brillant"
Wilhelmshavener Zeitung
"Scharfsichtige politische
Analyse im Romankleid"
Südwest Presse
"Mit erzählerischem
Raffinement und ironischer Schärfe"
Lausitzer Rundschau
"Komisch und verblüffend
zugleich"
ZDF-Morgenmagazin
"Leseleicht und spannend,
und es stimmt nachdenklich."
Meridian, Hessischer Rundfunk
"Eine phantastische
Geschichte"
Rheinischer Merkur
"Kraftvoller Beitrag"
Ostseezeitung
"Dagegen bleibt George
Orwell eher hypothetisch."
Südwestrundfunk
"Politmärchen,
das als soziologische Vision und Realsatire zugleich überzeugt."
Schweizer Illustrierte
"Das Buch sprüht
vor Einfällen und ist doch mehr als reine Phantasie."
Thüringer Allgemeine
"Mit seiner politischen
Horror-Story sorgt Ditfurth schon für einige Gänsehaut."
Hannoversche Allgemeine
"Grandioser sozialistischer
Pappkamerad"
Neues Deutschland
"Verblüffend
plausibel"
DDR im WWW
"Christian von Ditfurth
lügt! Und das in einer unverschämten Weise."
Radio Campus, Bochum
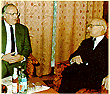
Kontakt
Christian v. Ditfurth
Wrangelstr. 91
10997 Berlin
Tel.: (030) 65006136
Fax: (030) 96601198
E-Mail
Probekapitel:
Prolog
Glücklich, wer's
in Zürich aushält. Heute bin ich über den Utoquai zur Bellerivestrasse spaziert,
strahlender Sonnenschein, links vorn, leicht ansteigend, der Riesbach, knapp
500 Meter hoch, rechts der Zürichsee, blau mit weißen Tupfen - Segelboote,
Ausflugsschiffe.
Gestern hatte ich die andere Route genommen, bin von der Nordspitze des Sees
zum Belvoir-Park gelaufen, habe dort auf einer Bank dem munteren Treiben zugesehen:
spielende Kinder, turtelnde Pärchen, alte Menschen auf der Flucht vor der
Einsamkeit. Am Strandbad Geschrei, wildes Treiben, Gespritze, weit draußen
ein Schwimmer mit blau-weißer Badekappe, der mit kräftigen Zügen das Wasser
teilt. Hoffentlich überfährt ihn nicht ein unvorsichtiger Segler.
Hier ist es immer wärmer, als es die Breitengrade eigentlich zulassen. 1963,
vor 36 Jahren also, ist der See das letzte Mal zugefroren, hat man mir erzählt.
Ich stelle mir Schlittschuhläufer vor, die den See wiegenden Schritts vom
Mythenquai zum Zürichhorn überqueren. Ob ich das noch einmal erlebe? Wann
kommt der nächste Eiswinter? Wo werde ich dann sein? In Deutschland? Kaum.
In der Stadt strotzt es vor Reichtum. Viel davon verdankt sie der Haupterwerbstätigkeit
der Zürcher, dem Geldvermehren. Ein wenig aber auch "seinen" Flüchtlingen,
Menschen, die Krieg und Unterdrückung in die ewig friedliche Schweiz trieben,
viele davon nach Zürich. Richard Wagner und Gottfried Büchner waren hier,
der große deutsche Baumeister Gottfried Semper schuf Mitte des vergangenen
Jahrhunderts das Polytechnikum, das später als Eidgenössische Technische Hochschule
(ETH) Albert Einstein aufnehmen sollte. Zürich war in der Zeit des Sozialistengesetzes
das Zentrum der sozialdemokratischen Emigration. Julius Motteler, der "rote
Feldpostmeister", fand immer Wege, den "Sozialdemokrat", das illegale Parteiblatt,
über die deutsche Grenze zu schmuggeln. Heute wäre das ein selbstmörderisches
Unterfangen.
Lenin war verschiedentlich in Zürich. Von hier aus durchquerte er 1917 in
einem plombierten Eisenbahnwaggon mit Genehmigung von Hindenburgs Oberster
Heeresleitung Deutschland, um in Rußland seine "Aprilthesen" zu verkünden:
Die Bolschewiki wollten mit friedlichen Mitteln an die Macht. Was aus dieser
Absicht wurde, wissen wir. Und auch, was dem Putsch in Petrograd im Oktober
folgen sollte. Ein Schlüsseldatum der Weltgeschichte, in den folgenden Jahrzehnten
kamen Millionen von Menschen um oder wurden eingesperrt. Wie viele Menschen
mögen noch in den Isolierungslagern der Demokratischen Republik Deutschland
(DRD) sitzen, obwohl die Aprilkrise, der Aufstand von 1993, schon sechs Jahre
zurückliegt?
Nur eine vergleichsweise kleine Minderheit konnte sich vor Tod oder Haft durch
Flucht retten. So wie ich. Insofern hatte ich Glück. Oder ich hatte besser
vorausgesehen, was kommen würde. Vielleicht aber war ich einfach nur ängstlicher
als die meisten Mitmenschen. Nur gab dieses Mal die Wirklichkeit meiner Angst
recht.
Aber warum klage ich? Es geht mir besser als vielen jener knapp 40 000 deutschen
Emigranten in Zürich und auch besser als jenen 300 000 Frauen, Männern und
Kindern, die seit 1989 in die Schweiz geströmt sind. Ich lebe nicht nur von
der kärglichen Flüchtlingsunterstützung und bin auch nicht ohne Arbeit, sondern
kann immerhin manchmal einen Artikel in einer schweizerischen oder österreichischen
Zeitung unterbringen, und für diesen Bericht habe ich sogar einen Verlag gefunden.
Inzwischen gelingt es nur noch wenigen Wagemutigen, das neue Deutschland zu
verlassen. Die meisten Flüchtlinge werden von den deutschen Grenzsoldaten
ergriffen. Jedes Jahr sterben zig Menschen unter den Schüssen der Grenzposten
oder im Splitterhagel der Minen und Selbstschußanlagen. Man hört auch immer
wieder von Leuten, die an der Schweizer Grenze abgewiesen und nach Deutschland
zurückgeschickt werden. Aber darüber findet man kein Wort in den deutschen
Zeitungen, auch nicht in den schweizerischen. Es scheint fast so, als gäbe
es ein stillschweigendes Einvernehmen zwischen den Deutschen und den Schweizern,
die Lage an der Grenze nicht eskalieren zu lassen.
Überhaupt halten sich die Politiker und Medien hier zurück. Kaum ein schlechtes
Wort über den Nachbarn. Statt dessen immer wieder Verständnis und der Verweis
darauf, daß Konfrontation die Reformkräfte in Deutschland nur schwächen würde.
Erst wenn die Deutschen das Gefühl bekämen, sie wären respektierte, gleichberechtigte
Nachbarn, könne sich der Sozialismus reformieren, behaupten einige Schweizer
Politexperten.
Viele wollen das glauben, aber diese Hoffnung ist auch ein Ergebnis der massiven
Kritik der Berliner Regierung an den Eidgenossen, die nach deutscher Auffassung
ihre Grenze zu lange als "Schweizer Käse" betrachtet hatten, wie die "Frankfurter
Allgemeine Zeitung" hämisch kommentierte: zu viele Löcher für zu viele Menschen.
Von einer "böswilligen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des souveränen
Deutschlands" hatte DRD-Ministerpräsident Karsten D. Voigt gesprochen, und
das klang in manchen Schweizer Ohren wie das Rasseln von dreißig Panzerregimentern.
Voigt beklagte sich vor allem über die deutschen Flüchtlingsvereinigungen
in der Schweiz, die sich mühten, Kontakte nach drüben aufzubauen und Menschen
bei der Flucht zu helfen.
Tunnel waren gebaut worden und Fesselballons waren nachts über die Grenze
geschwebt, bis deutsche Grenzsoldaten einige mit Maschinengewehrsalven heruntergeholt
hatten. Aber inzwischen ist die Entspannung weit fortgeschritten. Sieht man
ab von wenigen "unerfreulichen Zwischenfällen an der gemeinsamen Grenze",
so die Regierung in Bern, gibt es keine Streitpunkte mehr zwischen Deutschland
und der Schweiz.
Außer uns Emigranten. Über uns zanken sich mehr und mehr auch die Schweizer.
Wir kosten Geld, auch wenn man meinen sollte, davon gäbe es hier genug. Wir
sind der Grund für Ärger mit der deutschen Regierung, die mit Penetranz von
Bern fordert, den "friedensfeindlichen Sumpf trockenzulegen". Ohne uns würden
die Geschäfte mit dem mächtigen Nachbarn besser laufen, behaupten einige,
ohne aber Beweise anführen zu können. Außerdem nähmen wir Schweizern Arbeitsplätze
weg. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis Gruppen, nicht nur aus dem
rechten politischen Lager, einen Volksentscheid erzwingen darüber, ob wir
hier bleiben dürfen oder gehen müssen. Und wenn wir gehen müssen, wohin?
Hier in Zürich lebe ich zwar in der Fremde, fühle ich mich eingeschnürt und
abgelehnt von vielen Einheimischen, aber die Menschen sprechen Deutsch, wenn
es auch oft schwer verständlich ist. Bei aller geschäftstüchtigen Selbstbeschränkung,
Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten immerhin aus Deutschland, und wer
zwischen den Zeilen lesen kann, entdeckt aufschlußreiche Facetten der deutschen
Wirklichkeit.
Natürlich lese ich jeden Montag den "Spiegel" und bewundere es fast, mit welch
ausgefeilter Rabulistik das Blatt die Kurve kriegte. Fast so elegant wie die
"Zeit", aber unterhaltsamer. Ex-"Spiegel"-Herausgeber Rudolf Augstein sitzt
irgendwo im Tessin, und der neue, jugendliche Chefredakteur, Günter Quirl,
zeigt Biß, wenn auch mit begrenztem Feindbild. Soviel Lob über die Regierung
hat man im Hamburger Magazin nie zuvor gelesen - alles im Zeichen der "Verantwortung
für den Frieden". Um so heftiger drischt das Blatt auf uns ein. Gerade diesen
Montag wurde der "Emigrantenmafia in der Schweiz" mal wieder nachgewiesen,
daß sie sich auf Kosten der braven Eidgenossen ihren fruchtlosen Intrigen
gegen das neue Deutschland widme, wenn sie nicht gerade Skandälchen hervorbringe.
In Österreich und anderen westeuropäischen Ländern sei es nicht besser.
Und dann stand da als ein Beweis für diese Unterstellung Süffisantes über
Helmut Kohl und seine einstige Bürovorsteherin Juliane Weber, die beide in
Österreich, am Wolfgangsee, leben, während Hannelore Kohl in Oggersheim geblieben
ist. "Ich und meine Kinder, wir sind und bleiben Deutsche und kehren unserem
Vaterland auch in schweren Zeiten nicht den Rücken", zitiert der "Spiegel"
die Gattin des Ex-Kanzlers.
Die meist weniger geschickten Beschimpfungen und Lügen der großen und der
kleinen Blätter aus Deutschland, der Radio- und TV-Sender schmerzen mich kaum
noch. Aber immer wieder bitter ist es, die "Rheinische Post" zu lesen. Es
gibt sie im Zeitschriftenladen im Hauptbahnhof. Bei der "Rheinischen Post"
in Düsseldorf habe ich bis zu meiner Flucht im Januar 1996 gearbeitet. Ich
war keine der berühmten Edelfedern, die sich heute, wenn sie nicht emigriert
sind, für die durchsichtigen Schmeicheleien von ZK-Sekretär Peter Boenisch
mit gefälligen Artikeln bedanken. Ich war Sportredakteur und erfreute mich
des Respekts meiner Kollegen, sofern sie mich denn wahrnahmen. Ich war einer
jener fleißigen und zuverlässigen Schreiberlinge, ohne die eine Zeitung nicht
funktioniert. Ich war austauschbar, aber warum hätte man mich austauschen
sollen? Ich wußte eine Menge über Fußball, Reiten oder Leichtathletik, und
meine Berichte kamen an. Das zeigten jedenfalls hin und wieder Leserbriefe.
Für Politik hatte ich mich damals kaum mehr interessiert als Otto Normalverbraucher.
Lange hatte ich geglaubt, mich mit den neuen Umständen arrangieren zu können.
Natürlich paßte mir die deutsche Vereinigung nicht, jedenfalls nicht so, wie
sie durchgeführt wurde. Sicher, ich hatte den Diskussionen der Kollegen in
der politischen Redaktion zugehört, von denen einige die Zukunft in schwärzesten
Farben malten. Aber hatte nicht unser Chefredakteur, Gerhart Gerstig, erklärt,
es werde nichts so heiß gegessen, wie es gekocht werde? Hatte er nicht geraten,
ruhig zu bleiben, die neue Regierung nicht zu provozieren und seine "Pflicht
als Deutscher" zu tun? Ich hatte in dem Glauben gelebt, daß mir sowieso nichts
passieren könne. Auch in der "antimonopolistischen Demokratie" würde Sport
getrieben und mußte es Leute geben, die darüber berichteten. In der Tat ließ
mich der Betreuer des Informationsministeriums, einige nannten ihn Uhu, lange
Zeit unbehelligt, länger jedenfalls als meine Kollegen von der Politik. Aber
dann war auch ich an der Reihe.